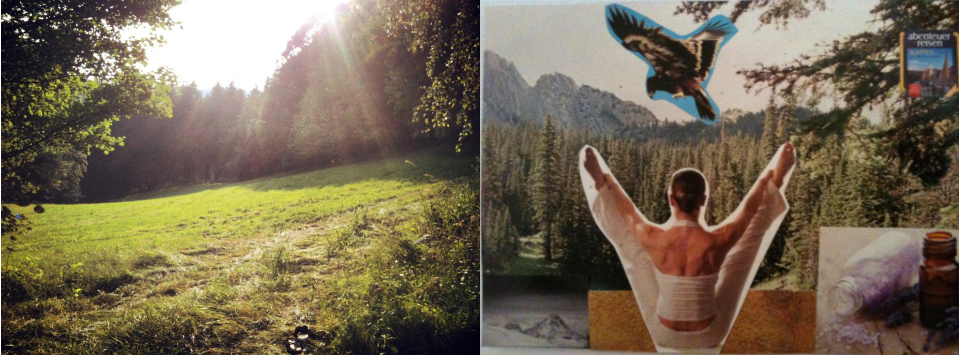Die schlanke Bode fließt im Thale
Um manchen Berg und Felsenhang,
Macht her und hin manch liebe Male
Umweg und krummen Wiedergang.
Doch eh’ von den granitnen Riesen
Den Durchlaß donnernd sie erzwingt,
Im breitern Grunde Wald und Wiesen
Ihr muntrer Wellentanz umspringt.
Manchmal verzieht sie wohl die Lippe
Und schmollt und bäumt sich launisch auf,
Daß Schaum umsprudelt Stein und Klippe,
Die ihr versperrn den flinken Lauf;
Schnell aber ist sie wieder heiter,
Strahlt silberhell und blinkt und glänzt,
Versäumt sich hier, läuft rasch dort weiter
Und spielt und lächelt, bunt bekränzt.
Die hellen Wiesen läßt sie trinken
Aus der Hand und aus dieser bald,
Und bald zur Rechten, bald zur Linken
Schmiegt sie sich an den dunklen Wald
Und lockt ihn, daß er niedersteige,
Zu baden sich in ihrem Thau,
Und überhängend seine Zweige
In ihrem blanken Spiegel schau!
Da sehn von oben Buch’ und Erle
Und Wolken, Sonn’ und Mond hinein,
Und unten ziehn Forell’ und Schmerle,
Glashell liegt Sand und Kieselstein.
Und zu dem Fächeln und dem Säuseln
Im schattenkühlen Laube stimmt
Im klaren Fluß das Wellenkräuseln,
Mit Rauschen, Plätschern, Murmeln schwimmt,
Was in den märchenkund’gen Quellen
Aus schatzgefüllten Tiefen schied,
Im Zwiegesang von Wind und Wellen
Erklingt ein träum’risch Zauberlied.
An lauschig stillem Plätzchen saßen
Des Grafen und des Köhlers Kind
In einer Uferbucht und maßen
Ums Haupt sich blumiges Gewind.
Wulfhilde band mit seinem Zwirne
Waldtraut zum Kranz Vergißmeinnicht,
Und Waldtraut flocht für Wulfhilds Stirne
Frischgrüne Blätter voll und dicht.
Wulfhilde wollte in dem Kranze
Für sich kein blumenbunt Geflecht,
Das Laubwerk nur mit dunklem Glanze
Der ernsten Eiche war ihr recht.
Und wie sich Blum’ an Blume fügte,
Zur Ründung wuchs der Blätter Schaar,
Schlang Jede, prüfend, ob’s genügte,
Ihr Kränzlein um der Andern Haar.
Wie ähnlich war und wie verschieden
Der beiden holden Mädchen Art!
Zwiefach gesondert und gemieden,
Zu Einem wiederum gepaart.
Sie glichen sich wie aus dem Meere
Zwei Perlen, fast im Ebenmaß,
Und wie die duft’ge Walderdbeere
Der edlen Gartenananas.
Wulfhildens Wuchs zwar überragte
Der Freundin zartern Gliederbau,
Die zu ihr aufsah, wenn sie fragte,
Doch Beider Augen waren blau.
Um Wulfhilds Schönheit wogte golden
Der frei gelösten Locken Fall,
Um Waldtrauts Schläfen, der Vielholden,
Wand sich lichtbrauner Flechten Schwall.
Doch ähnlich wie bei Schwestern zogen
Sich alle Linien weich und rund,
Der Brauen sanft geschwungne Bogen
Und Rosenwangen, Purpurmund.
In Wulfhilds ganzem Wesen regte
Sich ihrer Herkunft stolze Kraft,
Jedoch ein Zug von Schwermuth legte
Ihr Lächeln selbst in milde Haft.
Aus Waldtrauts Augen aber lachte
Schalkheit und Herzens Lieb’ und Lust,
Und was sie sprach, und was sie dachte,
Kam wie aus eines Kindes Brust.
Die Tage, die die Wunde heilten
An Waldtrauts Schulter, machten auch,
Daß die zwei Mädchenseelen theilten
Der innersten Gedanken Hauch.
Wenn Eine, was sie wußte, sagte,
Ihr Ohr die Andre willig lieh,
So lehrte diese, jene fragte,
Und liebend lernten Beide sie.
»Mich soll es wundern,« frug zur Stunde
Waldtraut, »ob du es wirklich weißt,
Aus welcherlei Betracht und Grunde
Vergißmeinnicht dies Blümchen heißt.«
»Nun,« sprach Wulfhild, »das soll bedeuten,
Daß, wem geschenkt die Blume ist,
In Heimlichkeit vor andern Leuten
Den lieben Geber nicht vergißt.«
»Ja wohl! so heißt es aller Enden,«
Lacht Waldtraut, »doch es ist nicht wahr,
Es hat ganz anderes Bewenden,
Gieb Acht! ich mach’ dir’s offenbar:
Wenn Einem schon die Wünschelruthe
Auf einen Schatz im Boden schlägt,
Thut’s Noth, daß er an seinem Hute
Die seltne blaue Blume trägt;
Die öffnet ihm die dunklen Tiefen,
Er sackt nun ein, so viel er kann,
Die Drachen, die beim Horte schliefen,
Sehn zu und hindern nicht den Mann.
Er legt den Hut ab mit der Blume,
›Greif’ einen Griff, streich’ einen Strich!‹
Tönt’s aus der Tiefe Heiligthume,
Hat er genug, heißt’s: ›Packe dich!’
Er rafft nun Alles schnell zusammen,
Denkt jetzt an Hut und Blume nicht
Und eilt, verfolgt von rothen Flammen,
Da ruft’s ihm nach: ›Vergiß mein nicht!‹
Das Blümchen ist’s; ließ’ er’s im Stiche,
Fänd’ er des Weges nicht zurück
Und seiner Schätze Glanz verbliche,
Drum an dem Blümchen hängt sein Glück.
Nun läßt man dies hier dafür gelten,
Weil’s blau ist, nennt’s Vergißmeinnicht.
Die echt’ ist’s nicht, die blüht gar selten,
Und wer sie findet, sagt es nicht.«
»Giebt es denn Schätze? fragt bedächtig
Wulfhild, »sind in der Tiefe Schoß
Nicht böse Geister übermächtig,
Feindlich gesinnt dem Menschenloos?«
»Gewiß! und wehe, wem als Meister
Ein Unhold je den Sinn bethört!
Doch giebt’s im Wald auch gute Geister,
Hast nie von Moosfräulein gehört?
Holzschläger, die drei Kreuze schneiden
In umgestürzten Baum, daß dann
Sich vor den wilden Nachtgejaiden
Moosweibchen darauf flüchten kann,
Beschenken sie in allen Ehren
Mit grünen Zweigen, dicht belaubt,
Die sich in eitel Gold verkehren,
Die Buschgroßmutter heißt ihr Haupt.
Und zieht der große Schimmelreiter,
Der Wode und sein wüthend Heer,
So geht als Menschenfreund und Leiter
Der treue Eckart vor ihm her
Und warnet vor dem Halsumdrehen,
Vor Hexenspuk und Zauberbann
Und Allem, was das Kreuz nicht sehen
Und Hahnenkraht nicht hören kann.
Beim Trinken geht in ihrem Kreise
Als Becher um ein Pferdehuf,
Hält einen Fuß im Wagengleise
Der Wandrer, thut ihm nichts ihr Ruf.«
»Sprich nicht so laut davon, mir grauet,«
Mahnt Wulfhild, »denk’ ich Jener nur,
Sag’, hast du jemals sie geschauet?
Fandst du im Wald schon ihre Spur?«
»Ich nicht, doch vieles Wundervolle
Erzählte mir Großmütterlein
Von Wod und seinem Weib, Frau Holle,
Oft zieht sie mit ihm, oft allein.
Einst war ihr goldner Pflug zerbrochen,
Da kamen klagend aus dem Tann
Die guten Heimchen vorgekrochen
Und holten ihr den Zimmermann.
Sie heißt die Eiserne, die Wilde,
Und schüttelt sie ihr Bett, o weh!
Dann schneit’s auf Berge und Gefilde,
Drum heißt sie auch Jungfrau im Schnee.
Sie lohnt und straft die Spinnerinnen
Und spricht: Wie’s Haar, so auch das Jahr!
Doch Niemand darf zur Rauchnacht spinnen,
Wer’s thut, begiebt sich in Gefahr.
Als mein jung Schwesterlein verschieden
Und Mutter weinte Tag und Nacht,
Hat sie allein zu Ruh und Frieden
Großmutter endlich doch gebracht.
Die sagt’ ihr, eine Mutter habe
Sich einst zu trösten nicht vermeint,
Auf ihres lieben Kindes Grabe
Die langen Nächte durch geweint.
Da zieht ganz nahe ihr zur Seite
Vorbei im Mondschein hell und klar
Frau Holle und hat im Geleite
Von Kindern eine große Schaar.
Und hinten, ganz zuletzt im Zuge
Ein Kindlein wankt mit müdem Schritt,
Schleppt sich mit großem, schweren Kruge
Und ächzt und stöhnt und kann nicht mit.
Der Weinenden das Auge flimmert, –
Es ist ihr Kind! das läßt den Schwarm,
Wirft sich an ihre Brust und wimmert:
»Ach! wie so warm ist Mutterarm!«
Dann aber fleht’s mit leisem Stammeln:
»Nicht weinen mehr! sei froh wie einst,
Ich muß ja all die Tränen sammeln
In meinem Kruge, die du weinst,
Sieh doch! ich kann ihn kaum noch heben,
Voll ist er, daß er überfließt,
Und ach! so schwer, daß er im Schweben
Mein ganzes Hemdchen mir begießt!«
Da nahm Urlaub von ihrem Leide
Die Mutter – und die meine auch.«
Wulfhild und Waldtraut schwiegen beide,
Bis daß ein Vöglein sang im Strauch.
Schnell über Waldtrauts Antlitz wieder
Flog’s wie ein goldner Sonnenstrahl,
Und zwitschernd wie des Vogels Lieder
Frägt sie: »Kennst ihn? kennst den nicht mal!?
Mein Liebling ist’s, Rothkehlchens Reigen!«
»Dein Liebling!« lacht Wulfhild, »jetzt bald
Sag’ mir, wie viel auf allen Zweigen
Hast du der Liebsten wohl im Wald?
Denn deinen Liebling nennst du Jeden,
Den du grad siehst, und hörst ihm zu,
Möcht’st wohl mit Jedem heimlich reden,
Du Schelm! mein Liebling selber du!«
»O höre doch die süße Stimme!
Die hat mir’s nun mal angethan,
Der Waidmann mag es nicht, der Grimme,
Denn es warnt Kibitz und Fasan;
Es schützt das Haus vor Blitz und Wetter,
Beißt sich herum mit Fink und Spatz,
Da sitzt es! sieh! hier durch die Blätter,
Sieh doch den kleinen rothen Latz!
Liegt Einer drin im Wald erschlagen,
Rothkehlchen schafft ihm Grabesruh,
Mit Blumen, die es bringt getragen,
Deckt es des Todten Antlitz zu.«
»O Märchenweisheit ohne Ende!
Dir schwatzen’s wohl die Vögel vor
Am Zaubertag der Sonnenwende,
Und Blumen flüstern dir’s ins Ohr?«
»Kann sein!« lacht Waldtraut, »Kraft und Namen
Weiß ich der ganzen Kräuterei,
Geht Einer in den grünen Samen
Zu horchen, hört er Mancherlei.
Und denkst du denn, die Blumen alle
Sind stumm? O jedes Blättchen spricht
Mit tief geheimem Laut und Schalle,
Wir Menschen hören es nur nicht,
Dein Ohr ist taub nur ihrem Singen,
Und damit ist uns Recht geschehn,
Man könnt’ ja sonst vor all dem Klingen
Sein eigen Wort nicht mehr verstehn.«
»Jetzt halte still dein Sonntagsköpfchen,«
Spricht Wulfhild, »fertig ist dein Kranz,
So! ei wie hübsch! manch braunes Zöpfchcn
Lugt vor, siehst aus, als ging’s zum Tanz.«
»Auch der!« sagt Waldtraut, »und nun bücke
Ein wenig dich zu mir herab,
Daß ich dir in die Locken drücke,
Was ich für dich gewunden hab’,«
In Waldtrauts Haar das sternenlichte,
Das leichte, zarte Blumenband
Stand ihrem lieblichen Gesichte
Wie ein Geschenk aus Feeenhand.
Doch Wulfhilds stolzes Haupt verschönte
Des vollen Kranzes Eichengrün
Und ließ die jungfräulich Gekrönte
Wie eine holde Fürstin blühn.
Mit Freuden hält und halb mit Zagen
Waldtraut auf sie den Blick geprägt
Und spricht gedankenvoll: »Sie sagen,
Wer grüne Eichenblätter trägt,
Der liebt mit steter, fester Treue,
Nichts ist, was seinen Willen bricht,
Ob Leid ihn drücke, Glück ihn freue,
Er rühmt sich seiner Liebe nicht.«
»Glück?« seufzt Wulfhild und schüttelt leise
Und lächelt trübe vor sich hin,
»So hoch ich meine Liebe preise,
So tief auch liegt mir Leid im Sinn.«
»Du zweifelst noch in stummen Klagen?
Wer bangt und seinem Glück nicht traut,
Soll Espen und Wachholder tragen
Und röthlich blühend Heidekraut,
Das deutet frohe Augenweide,
Gemischt mit bittern Schmerzen oft,
Und mahnt, daß Einer sich entscheide,
Und zeigt, daß Eine auf ihn hofft.«
»Ich hoffe nicht und will nicht mahnen,
Mich schmerzt, was meine Augen sehn,
Wer mich nicht liebt, soll auch nicht ahnen,
Wie meine stillen Wünsche gehn.«
»So trag’, als fordertest zum Streite
Du Einen, blauen Rittersporn
Und weis’ ihn von dir in die Weite
Mit einem spitzen Rosendorn.«
»Laß sein, lieb Kind, nichts mehr von Schmerzen!
Zeig’ mir ein fröhliches Gesicht
Und sage mir so recht von Herzen,
Wer trägt denn wohl Vergißmeinnicht?«
»Vergißmeinnicht, wem das empfohlen,
Der mag sich Trostes Wohl versehn,
Der liebt und wird geliebt verstohlen,
Doch darf er’s noch nicht eingestehn.«
»Mir aber hast du’s doch gestanden,
Was mir nicht lang verborgen blieb,
Wie sich zwei junge Herzen fanden
Im Wald, – du hast den Jäger lieb;
Wie werden roth nun deine Wangen,
Du liebes, braunes Reh, schau’ an!«
Und Waldtraut lächelte befangen
Und sang ein schelmisch Liedchen dann.
Ich ging im Wald
Durch Kraut und Gras
Und dachte dies
Und dachte das,
Da hört’ ich es kommen und gehn, –
Husch! husch!
Hintern Busch!
Da hat mich ein Jäger gesehn.
Hab’ mich geduckt,
Durchs Laub gespäht
Und wollte fort,
Da war’s zu spät,
Sein Hündlein kam spürend getrappt
Husch! husch!
Hmter’m Busch,
Da hat mich der Jäger ertappt.
Er frug, warum
Ich mich versteckt,
Ob er mir Furcht
Und Angst erweckt,
Ich sagte: O daß ich nicht wüßt’!
Husch! husch!
Hinter’m Busch –
Husch! hat mich ein Jäger geküßt.
Wulfhild hat ihren Arm geschlungen
Um Waldtrauts Nacken, drückt ans Herz
Die Freundin, wie das Lied verklungen,
Doch plötzlich schreit sie auf in Schmerz,
Und Waldtraut, selber schreckergriffen,
Frägt schnell: »Was ist dir? was geschah?«
»Ein garstig Thier hat mich gekniffen
Mit seinen Zangen, da! sieh da!«
»Hirschkäfer, o!« schilt Waldtraut zornig
Und nimmt ihn von der Schulter sich,
»Mit dem Geweih, gezackt und dornig,
Was unterstehst du, Brauner, dich!?
Er denkt, du wolltest mich beleid’gen,
Brächt’st mich in deinen Armen um,
Wulfhild, drum wollt’ er mich vertheid’gen, –
Hornschröter, sei doch nicht so dumm!«
Sie hält Wulfhildens Hand umfangen
Und spricht: »Man sagt ihm Böses nach,
Er trüge mit den großen Zangen
Uns glüh’nde Kohlen auf das Dach;
Das ist nicht wahr, ich kenn’ ihn besser,
Wir Köhler wissen, was er thut,
Unschuldig ist er, doch ein Fresser,
Der in der Eichenlohe ruht.
Fleuch’, Großer, fleuch’ auf gutem Winde
Zur Eiche, die beim Fuchsfang steht,
Hat einen Spalt in kranker Rinde,
Draus saftig Harz hernieder geht.«
Des Schröters Fühler hoch sich recken,
Als spitzt’ er lauschend so das Ohr,
Dann hebt er seine Flügeldecken,
Und brummend schwingt er sich empor. –
Die von dem Kranze übrig blieben,
Die Blumen nahm Waldtraut und schlang
Mit frischen, jungen Eichentrieben
Zu einem Sträußchen sie und sang:
Blaublümlein spiegelten sich im Bach
Und riefen den eilenden Wellen nach:
Vergißmeinnicht!
Die lachten: Wir müssen zum Meere hin,
Und aus den Augen ist aus dem Sinn,
Vergißmeinnicht!
Blauäuglein hatte ein Mägdelein,
Die strahlten dem Knaben ins Herz hinein:
Vergißmeinnicht!
Der Knabe zog in die Welt hinaus,
Da blühte und welkte manch Blumenstrauß.
Vergißmeinnicht!
Und als er allein auf unendlicher See,
Da grüßten ihn Sterne, da faßt’ ihn ein Weh,
Vergißmeinnicht!
Aus rauschenden Wogen sangen herauf
Die Tropfen im Meere aus Bächleins Lauf:
Vergißmeinnicht!
»Vergessen! ja, wer’s kann im Leben,«
Sprach Wulfhild halb zu sich, »der mag
Sich seiner Sorgen wohl begeben,
Doch wer vor Augen jeden Tag
Ein Glück, so nah, so gern besessen
Und dennoch ewig unerreicht,
Ach, Kind! der lernt wohl nicht vergessen,
Wenn auch die letzte Hoffnung weicht.
Ich sollte schweigen und muß reden,
Was mir aus vollem Herzen bricht,
Es heißt, die Zeit vertröste Jeden,
Mir sagt das Leid: vergiß mein nicht!
Weiß auch ein Lied, – soll ich’s dir singen?
Von einem Herzen ohne Ruh,
Dir wird es fremd und thöricht klingen,
Und doch hat’s Wahrheit, – höre zu!«
Leer ist der Tag, er geht zu Ende,
Fort, heißes, unbarmherziges Licht!
Komm, süße Trösterin Nacht und sende
Herauf mir mein liebes Traumgesicht.
Dann seh’ ich ihn wieder mit Entzücken,
Den Stern meines Lebens, der mir verblich,
Und ich darf an die sehnende Brust ihn drücken,
Und es träumet mein Herz, er liebte mich.
Seine Hand so warm, seine Lippen so wonnig,
Und er spricht es zu mir, das berückende Wort,
Seine Stirn so klar, sein Auge so sonnig,
Durch alle Himmel trägt er mich fort. –
Und das Alles nicht wahr, geträumt und gelogen!
Und vom dämmernden Morgen der kühle Bescheid:
Todt Liebe und Hoffnung, verschmäht und betrogen,
Lebendig nur Schmerz und unendliches Leid.
Nicht lieben zu dürfen, nicht hassen zu können,
O grausame Qualen, wer hat euch erdacht?
Und wollen die Tage das Glück mir nicht gönnen,
So belüge denn du mich, sinkende Nacht!
Waldtraut, als hätt’ sie kaum verstanden
Und ahnte doch der Freundin Schmerz,
Saß schweigend, ihre Augen fanden
Den Weg in Wulfhilds trauernd Herz.
An Wulfhilds Wimpern aber glänzten
Der kummerschweren Thränen zwei,
Das stand der Eichengrünbekränzten
Wie Schnee dem blüthenreichen Mai;
Doch rang sie die Bewegung nieder
Und reichte Waldtraut ihre Hand
Und lächelte und sprach dann wieder,
Zur liebsten Freundin hingewandt:
»O laß mein Schmerz dich nicht bethören,
Du bist ja glücklich, kennst kein Leid,
Laß noch ein frohes Lied mich hören!«
Und wieder sang die holde Maid.
Alle Blumen möcht’ ich binden,
Alle dir in einen Strauß
Und mit Kränzen dich umwinden,
Daß du lachend säh’st heraus.
Alle Vögel möcht’ ich fangen,
Alle dir nach meinem Sinn,
Wenn sie in den Zweigen sangen,
Wies ich stets zu dir sie hin.
Alle Schätze möcht’ ich heben,
Alle aus der Tiefe Schoß,
Daß ich dir sie könnte geben
Und du würdest reich und groß.
Ach! was kann ich, und was hab’ ich!
Bin ich doch so arm wie du,
Was ich hatte, ach! das gab ich,
Und mich selbst, mich selbst dazu.
Im Grase thaut’s, die Blumen träumen
Von ihrem bunten Honigdieb,
Und oben flüstert’s in den Bäumen:
Schläfst du? schläfst du, mein trautes Lieb?
Der Mond scheint durch den grünen Wald.
Ein Aestlein wankt mit leisem Wiegen,
In dunkler Blätterheimlichkeit
Regt sich ein Kosen, Schweben, Schmiegen:
Dir treu, dir treu in Ewigkeit!
Der Mond scheint durch den grünen Wald.
Nun wird es still in Luft und Zweigen,
Ein wonnig Athmen hebt die Brust,
Dich küßt die Nacht mit süßem Schweigen,
Ruh’ aus, ruh’ aus von Lieb’ und Lust,
Der Mond scheint durch den grünen Wald.
Es schlüpfte durch Gebüsch und Ranken
Ein frischer, kühler Wisperhauch,
Ein Schauern, Zittern dann und Schwanken
Begann in jedem Baum und Strauch.
Von ungefähr heran geflogen
Durchs Laub ein mächtig Rauschen brach,
Und als vorüber das gezogen,
Folgt’ ihm ein langes Flüstern nach.
Es war des Abendwindes Wehen,
Der über Blatt und Blüthe strich,
Als ob im Wald er auf den Zehen
Sich heimlich durch die Dämm’rung schlich.
Die Mädchen brachen auf und trafen,
Vom Birschgang kommend mit dem Stahl
Und ihrer Beute froh, den Grafen
Und Albrecht nah der Burg im Thal.
Bruno trug mit verbrochnem Laube
Des Grafen Rehbock nach dem Schloß,
Und Ludolf hinter sich im Staube
Schleift’ einen Wolf, den Albrecht schoß.
So wie das Herz Jedwedem pochte,
War auch der Gruß, den Jeder bot,
Und wer am liebsten schweigen mochte,
Der schwieg, war reden ihm nicht noth.
Waldtraut verrieth mit warmen Blicken
Dem jungen Jäger ihr Gefühl,
Wulfhild erwiederte mit Nicken
Den Gruß des Vetters stumm und kühl.
Der Graf sah sinnend, lächelnd Beiden
Tief in die Augen, stand und stand,
Als könnt’ er von dem Bild nicht scheiden,
Das er hier doppelt vor sich fand.
Der Junker sprach: »Schau! liebe Muhme,
Wie schön steht dir das Eichengrün!
Doch warum keine einz’ge Blume
Läßt du in deinem Kranze blühn?«
»Wir theilten,« sprach mit leisem Beben
Wulfhild, »die sommerliche Zier,
Um Waldtraut lichte Blüthen schweben,
Der Eiche zähes Blatt ward mir.«
»Und wenn ich beide Euch vergleiche,
Find’ ich die Wahl nach Fug und Pflicht,
So schütze denn, du starke Eiche,
Das liebliche Vergißmeinnicht!«
Sprach mild der Ritter, als bewegte
Schon längst entschwundne Seligkeit
Den hartgewöhnten Mann und regte
Sich ihm ein längst bezwungnes Leid.
»Du Waldtraut,« sprach er freundlich weiter,
»Du bittest nie, sagst niemals: gieb!
Sag’s heute! bin so froh und heiter,
Ich thu’ dir, was ich kann, zu lieb!«
»Dank Euch, Herr Graf! so bitt’ ich heute,
Daß Ihr den großen Eber schlagt,
Der Saat und Frucht der armen Leute
Verwüstet, wie sie mir geklagt.«
»Und weiter weißt du nichts zu sagen?
Ei, Kind, bei meiner Waidmannsehr!
Sollst bald an deinem Halse tragen
Des groben Keilers scharf Gewehr,«
Lacht’ Hackelberend, »morgen gehen
Zu Holz wir, wo er stecken mag.«
»Und wir, Großmütterlein zu sehen,
Und bleiben dort den ganzen Tag,«
Sagt Wulfhild; mit beredtem Schweigen
Dankt Waldtraut, blickt den Jäger an,
Und Alle wenden sich und steigen
Nun wohlgemuth zur Burg hinan.
Schwül ist die Luft, nicht Mond, nicht Sterne
Streu’n ihr verheißungsvolles Licht,
Aus dunklen Wolken in der Ferne
Unheimlich Wetterleuchten bricht.
Julius Wolff